Magnus Klaue und Oliver Schott über die Liebe
September 22nd, 2011Auf der Treppe zum Klo war noch Platz, die Liebe trieb die Massen ins Ausland, und sie schienen dort letzten Donnerstag unter der Überschrift “Ich liebe doch alle Menschen…” ein Für (Oliver Schott) und Wider (Magnus Klaue) zu Polyamory zu erwarten. Doch Schott stellt seine “offene Beziehung” ausdrücklich der Polyamory-Bewegung entgegen und Klaue will an diesem “Ausdruck einer Misere” vorbei zur Kritik der Gesellschaft, die sie hervorbringt.
Außerdem wirkten beide bei aller Bestimmtheit und auch Schärfe in der Sache vom Tonfall her doch verblüffend nett, statt intellektuellem Ringkampf gab es eher freundliche Kritik und Selbstkritik unter Kollegen.
Schott zeichnete denn auch zunächst im leicht albernen Plauderton ein Bild von der Geschichte der Polyamory, für die er ein Verschwinden des ursprünglich feministischen Gehalts konstatierte, und vom heutigen Spektrum der Erscheinungsformen und Abgrenzungslinien. Während einige davon sprächen, daß die Liebe kein Kuchen sei, der aufgeteilt werden müsse, sondern eher ein Muskel, den man trainieren kann, würden andere veritable Gruppenehen führen, in die nur aufgenommen werden könne, wen alle Gruppenmitglieder dabei haben wollen. Vielfach gäbe es eine Abgrenzung zu Swingern, es würde betont, daß es nicht nur um Sex ginge, sondern um Liebe.
Für Schott gibt es ein Bedürfnis nach Namen für die Sache, die man treibt, am besten eine Sache mit Wikipedia-Eintrag. Dieser Bewegungsdynamik hält er die “offene Beziehung” entgegen, die nach keiner Schablone ablaufen soll, sondern offen in dem Sinn, daß es immer um Einzelfallentscheidungen geht. Dennoch findet Schott es gut, daß es nun die ganze Diskussion gibt, und wenn sich in dieser Hinwendung zu flexibleren Beziehungen neoliberales Denken spiegeln würde, dann hätte neoliberales Denken vielleicht positives Potential.

Magnus Klaue begann launig und mit sich selbst. Ihm wäre das alles viel zu viel Koordinationsarbeit, es wäre schon schwierig genug, überhaupt jemanden zu lieben, so daß sich im Ganzen die Frage stellen würde, wo denn die ganzen liebenswerten Menschen herkommen sollen. Polyamory ist für Klaue kein Ausweg, sondern Ausdruck von unbewältigter Ohnmacht und Angst, sprachlich zwischen Poesiealbum und BWL-Duktus à la “Beziehungsmodelle” oder “rationale Beziehungsführung”. (Hier schob er einen kurzen Verweis auf Niklas Luhmanns “Liebe als Passion” ein.)
Beziehungsgespräche, die man durch die Erfindung des Handys ja leider mitverfolgen müßte, würden die allgemeine Unfähigkeit zeigen, erfahrungsnah über Liebe und Verlust zu sprechen. Es gäbe eine Gleichzeitigkeit von Fetischismus (Beziehung unantastbar, der Begriff “Beziehung” überhaupt) und Verachtung (Vorläufigkeit, jederzeit abbrechbar, “Zusammensein”), die Menschen könnten nichts miteinander anfangen, können aber nicht ohne einander auskommen.
Für Klaue ist im Kontext der Polyamory das Eingeständnis verboten, ohne jemanden nicht sein zu können, allgemein das Eingeständnis von Schwäche. (Hier gab’s den obligatorischen Verweis auf Adornos Wort: “Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren” aus der Minima Moralia.) Man müßte mit allem klarkommen können, die Rolle spielen selbständig zu sein. Insofern sei Polyamory eine Form von Selbsttherapie, Kommunikationstherapie.
Ebenfalls solle man keine Geheimnisse voreinander haben, worin Klaue eine Mischung aus Transparenzideal und Geständniszwang erblickt. Für Klaue ist das Geheimnis wesentlicher Teil der Liebe, einerseits als das geteilte Geheimnis, das man vor der Welt hat (Kosenamen), andererseits aber auch als Geheimnis voreinander, dessen Zulassen eine Anerkennung von Intimität steckte.
Die so beschriebene Kombination von Arbeit und Toleranz wirkt als struktureller Protestantismus: “Protestantismus heißt Toleranz mit zusammengekniffenen Lippen.” Immer müsse man an sich arbeiten, es sei die Rede von Beziehungshygiene, die für Klaue die “schmutzige Wäsche” und die “schmutzige Phantasie” loswerden soll.
Er hingegen plädiert dafür, in der Liebe eben nicht zu arbeiten und in der Liebe nicht der bessere Mensch werden zu müssen. Es würde Liebe gerade ausmachen, den anderen erstmal in allen Fehlern und Schwächen zu bejahen: “Daß Liebe blind macht, ist ein freundlicher, zivilisatorischer Aspekt.”
Im Universum der Polyamory gelte es hingegen, Liebesfähigkeit als eine Sozialkompetenz zu erlernen, Polyamory erscheine als Beziehungsagentur für schwer Vermittelbare, die ständig mit anderen zusammen sein müssen, nicht allein sein können. Auch serielle Monogamie hieße lediglich, man stagniere wechselnd nebeneinander her. Immerhin hätte Monogamie vielleicht erst ermöglicht, sich in solchem Ausmaß auf eine Person einzulassen.
Die Erfahrung von Widersprüchlichkeit und Schmerz, von Verliebtsein und Verlassensein, würde unter Polyamorikern verdrängt. Für Klaue ist Liebe eine Erfahrung der Unversöhntheit mit sich und der Welt: “Liebe ist nicht die Versöhnung, sie verweist nur darauf.” Die Erfahrung von Verlust sei nicht möglich ohne die Erfahrung von Glück, und diese Erfahrung solle aber nicht aufkommen, stattdessen würde eine “falsche Immanenz” Ekstase und Askese verhindern. Entsagung sei eben nicht Verzicht, sondern hielte das Bessere fest, das man nicht findet. In der Polyamory-Welt sei die ganze Erfahrung von Selbstüberschreitung wegrationalisiert; sie würde im Grunde funktionieren wie das verschiedentlich geforderte Existenzgeld: Jeder kriegt mehr als vorher und schon sind alle zufrieden. Das beinhaltet für Klaue ein starkes resignatives Moment.
Nun war wieder Schott an der Reihe, der einerseits Klaue unspezifisch zustimmte, andererseits aber fragte, warum all diese Kritik eine Kritik an Polyamory sei. All das gäbe es ja, aber doch nicht nur dort. Begriffliche Konstruktionen seien nun mal leider nötig, sollten aber kritischer Reflexion zugänglich sein. Es gäbe weiterhin eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit von exklusiven Beziehungsmodellen. Auch wenn man die Antwort ablehne, die Polyamory gibt, sei es doch gut, daß die Frage überhaupt gestellt wird, was lange Zeit vorher kaum passiert sei. Gerade das Festhalten an der Liebe verlange nach einer Form der Kritik am exklusiven Modell.
Klaue antwortete wiederum, indem er die Ebene verschob, und fragte zurück: “Was sagt es über die Gesellschaft aus, daß über Modelle gesprochen wird?” Die lebendige Vielfalt der Liebe werde zu Modellen verdinglicht, Monogamie sei aber kein Modell, sondern eine historische Konstellation. “Ich hab kein Modell”, sagte er mit seinem charakteristischen, leicht genervten Tonfall. Die Rede vom Modell verharmlose die Gewalt in den Verhältnissen. Sich trotzdem mit dieser Begrifflichkeit anzufreunden, wie Schott es tut, sei resignativ.
Erfahrungsprobleme würden so auf Begriffsprobleme projiziert werden, es käme zu einem Begriffspositivismus, und Klaues Frage lautet: “Welche gesellschaftliche Erfahrung bringt diese Begriffe hervor?” Und: “Man verändert die Verhältnisse nicht, indem man sie anders nennt.” Überhaupt gäbe es gar nicht ganz viele Möglichkeiten, wie behauptet werde, sondern bloß zweieinhalb und die seien immer gleich. Die Frage der Polyamoristen an sich selbst würde doch lauten: Wie vergesellschafte ich mich auf der Höhe der Zeit?
Erneut sagte Schott, daß er Klaue in vielem zustimmen würde und daß sein Ansatz im Vergleich praktischer sei. Es gäbe keine guten Begriffe, weil die Debattenkultur fehle. An Begriffen wie “Friends with benefits” sei ja sichtbar, wie eng die Bahnen des Denkens und Wahrnehmens sind. Das Nachdenken nehme bedauerlicherweise begriffliche Form an. Zur Liebe, wie Klaue sie zu fassen versucht hatte, käme man aber nicht ohne Kritik am exklusiven Normalbetrieb.
Klaue meinte hierauf noch lakonisch, “meine Beziehung” zu sagen sei nicht besser als “meine Freundin”. Dann wurde die Runde geöffnet, und als erstes meldete sich der Administrator eines Polyamory-Forums, der etwas umständlich sagte: Es gibt solche, die es leben, und es funktioniert [!].
Darauf antwortete Klaue, er sei durchaus intolerant und: “Ich lebe nichts, ich lebe.” Er wollte wissen, warum viele Menschen so glücklich sind, wenn sie einen Begriff für das gefunden haben, was sie sowieso schon tun. Das sei Ausdruck von Entfremdung und Automatismus. Liebe sei aber etwas Unpraktisches, es ginge doch gerade darum, den anderen nicht praktisch zu behandeln.
Als nächstes wies eine Frau darauf hin, daß es mit der Ablehnung von “Beziehungsarbeit” schwierig wäre, da diese in der Monogamie von der Frau geleistet werde.
Schott betonte noch einmal, daß er Klaues Kritik an der Sehnsucht nach Selbstzuordnung teilen würde, machte aber eine Trennung von Leben und dem Nachdenken darüber auf. Er sagte, daß er die Unlösbarkeit anerkennen würde, es blieb aber unklar, was das heißt, wenn er doch eine Lösung zu unterstellen scheint.
Klaue wies darauf hin, daß der Begriff der “Beziehungsarbeit” aus der Psychotherapie kommt, was bedeuten würde, daß sich ein Krisenbegriff verallgemeinert, daß Leute nicht mehr miteinander klarkommen. Es sei wie mit dem “lebenslanges Lernen”, das sei ebenso ein Substitut für Erfahrungsunfähigkeit. Dabei käme aber das, was Klaue in Diskussionen über die Liebe erwarten würde, in dieser “Beziehungsarbeit” nicht vor: die Triebe, die Ängste, die Versagung, kurz, die Psychoanalyse. Stattdessen würde psychologisch weitgehend der Behaviorismus vorherrschen.
Hier mußte ich den Laden leider schon verlassen und rekonstruiere die restliche Diskussion aus Aufnahmen und dem, was mir noch berichtet wurde:
Klaue hatte nichts dagegen, daß über Liebe gesprochen wird, es würde nur so, wie es geschieht, der Sache nur nicht gerecht. Es sei sogar das, was am ehesten am Polyamory-Ansatz zu retten sei: daß über solche Probleme geredet wird. Auf den Einwurf den Forumsadministrators, wie Klaue denn über solche Beziehung sprechen könne, wenn er nie dabei gewesen wäre, antwortete dieser, es würden auf Leute über Raumfahrt schreiben, die nie im All waren. Er müsse nicht so leben, um darüber sprechen zu können. Der Administrator murmelte nun, Klaue sei also bar jeder Erfahrung. Jemand anders sagte, es gäbe einen Unterschied zwischen Erfahrung und Erlebnis. Wieder Gemurmel vom Administrator: “Das glaube ich nicht.”
Auf die Frage, wie heute, wo Monogamie nicht mehr historisch bedingt sei, darüber gesprochen werden kann, sagte Klaue, daß Monogamie heute in gewisser Weise nur als Modell gelebt werden würde, auch Ehe sei kaum noch etwas, das einem widerfahren würde, sondern eine Entscheidung. Wenn aber Formen, die sich gerade erst entwickeln, bereits als Modell behandelt werden, würde so mit einer Illusion von Selbsttransparenz historische Entwicklung mißverstanden werden. Geschichtliche Prozesse vollzögen sich teilweise hinter dem Rücken der Beteiligten, die sich somit noch gar keinen Begriff davon machen könnten. Polyamory als Ausdruck einer gesellschaftlichen Konstellation zu fassen, sei etwas anderes als zu sagen, es sei ein Modell unter vielen. Klaue stellte das nun in den Kontext eines “kybernetischen Paradigmas” (hm, Sympathy for Tiqqun?), eines “Automatismus der Selbstreflexion”, unter dem nichts einfach getan werden dürfe, sondern immer überlegt werden müsse, welche Rollenmuster man gerade erfüllen oder konterkarieren würde, ob man alles auf der Höhe seines kritischen Bewußtseins tun würde. Als Forderung sei das ja gut, als Automatismus der Selbstdisziplinierung aber problematisch. (Vgl.: The Contextualization Fairy.)
Frage: “Ist das nur bei Polyamory so?” Klaue: Dort würde stärker vollzogen, was sowieso passiert: “Diese Leute drücken uns das nicht auf, sie drücken es nur besonders deutlich aus.”
Einwurf: “In der Polyamory wird die Unversöhnlichkeit greifbarer.” Klaue: Es wäre aber keine Erfahrung, die einen mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert, sondern eine institutionalisierte Vergesellschaftungsform, in der ein echter Bruch gar nicht mehr stattfinden kann. Wie das Gerede von “Patchwork” oder Krise als Chance, liefere es keinen Erfahrungshorizont für die Zukunft, sondern alles müsse ständig schon realisiert werden und sei vorgegeben. Schott fragt, warum für Klaue Polyamory nur Ausdruck negativer Tendenzen sei, während Schott aus Gesprächen den Eindruck gewonnen hat, hier würde sich eine Frage erstmal wieder öffnen, sich neues Bewußtsein bilden, würden Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Die repressive Seite der monogamen Norm würde bei Klaue nicht vorkommen. Es wären auch nicht nur Begriffsfetischisten unter den Polyamory-Leuten, sondern viele, für die es nur ein Label ist, unter dem sie ihre Lebensweise vermitteln können als etwas, das nicht krankhaft ist.
Für Klaue bleibt die Frage, ob es denn wirkllich so sei wie behauptet, daß dadurch etwas unbehelligt von der Gesellschaft ermöglicht werde, oder ob nicht die Gesellschaft verinnerlicht werde und über lauter Dinge gesprochen, um über andere nicht sprechen zu müssen.
Nun gab es eine längere Wortmeldung aus dem Publikum: Ehe sei nicht mehr das durchgängige Modell, die historische Situation sei die, das Liebe vergeht, die Fähigkeit zur Liebe vergeht. Es müsse überlegt werden, was dem entgegengesetzt werden kann, daß wir nicht lieben können, daß wir immer verstümmelter werden. Askese könne das zu Bewußtsein bringen, während Polyamory vorgaukeln würde, es sei alles freier geworden. Es hätte doch mit unserer Überflüssigkeit zu tun, die uns narzißtisch kränkt, womit wir nicht klarkommen. Man suche etwas, wo man noch gebraucht wird, was doch aber dem Bedürfnis entgegengesetzt sei, sich in der Liebe fallenlassen zu können.
Schott sieht den Widerspruch nicht. Die objektiven Gegebenheiten wären schon so, aber das bloße Anerkennen davon brächte keinen Schritt weiter. Für ihn ginge es darum, der Liebesfähigkeit und Liebenswürdigkeit so nahe wie möglich zu kommen.
Klaue stellte nun klar, daß die Forderung nach Promiskuität für ihn kein Problem wäre, es ginge aber bei der Polyamory darum, daß man viele Menschen lieben könne, was er wiederum als eine Reaktion auf Lieblosigkeit ansieht. Polyamory erschiene als Rationalisierung und Eindämmung von Promiskuität. Es werde die Frustration vergesellschaftet, daß Promiskuität und der allmähliche Fall der Monogamie gar nichts Besseres bringen. Deshalb würden das Gefühl und die Liebe so wichtig werden, und diese Verquickung ist für Klaue problematisch.
Frage: “Hat es denn schon mal eine größere Fähigkeit zur Liebe gegeben?” Klaue antwortet, die Möglichkeit von Erfahrung sei duchaus weiterhin gegeben, Augenblicke, in denen sie möglich ist, seien aber partikular und störten im Alltag, könnten kaum noch vermittelt werden. Nicht umsonst würde heute anders darüber gesprochen werden.
Für Schott ist die Liebe aber noch am ehesten unter Menschen aufgehoben, die im weitesten Sinne unter polyamor laufen. Sich irgendwie bezeichnen zu müssen, hätte ja auch damit zu tun, daß man vom Umfeld, das Gesetzteslage und gesellschaftliche Erwartung auf seiner Seite hat, unter Rechtfertigungsdruck gesetzt wird. ’68 hätte keine anerkannte Form nicht-exklusiver Beziehung hinterlassen (so wie es mit vorehelichem Sex geklappt hat). Das gelte es nachzuholen.
Die letzte Frage richtete sich an Klaue: Was er denn zur Rettung emphatischer Liebe anzubieten hätte. Klaue machte sich darüber lustig: “Ja, wo bleibt denn das Positive?” Das käme ja immer: daß alles so negativ sei und gar nichts über unser praktisches Leben aussagen würde. Für Klaue ist aber in einer negativen Bestimmung der Realität ein Begriff davon enthalten, wie es besser sein könnte. Sie sei nötig, um sich bewußt zu machen, wie ärmlich und eingeschränkt die Sphäre des praktischen Lebens überhaupt ist. Das spräche nicht gegen den Versuch, in der Praxis klarzukommen, niemand solle sich jetzt umbringen. Das typische Abwägen von Vor- und Nachteilen dieses oder jenes Modells sei jedoch nicht so wahnsinnig prickelnd. Er habe nichts dagegen, wenn Menschen sagten, sie würden nicht-exklusive Beziehungen führen, er wolle das aber nicht gesagt bekommen. Im Begriff der Exklusivität stecke ja nicht nur Besitz, sondern auch der Zug vom Spezifischen zum Untauschbaren, zum Unverwechselbaren des Individuums: “Meinetwegen exklusive Beziehungen zu allen möglichen Leuten.” Für Klaue hat Polyamory etwas Schales und Kompromißlerisches. Es sei besser, das Falsche daran auf den Begriff zu bringen. Mehr könne er nicht anbieten.
Nun war nach mehr als zweieinhalb Stunden erst Schluß, ich war längst ganz woanders, hatte mir aber auf dem Weg dorthin noch allerlei Gedanken über die Veranstaltung gemacht, von denen ich hier noch einige wiedergeben will.
Als jemand, der seine Liebe immer in die Welt zu werfen versucht hat, der trotz aller Enttäuschungen und Verluste und trotz der Einsicht in die Unmöglichkeit, nein: enorme Umwahrscheinlichkeit, es nie aufgegeben hat, diese Liebe dennoch so innig wie möglich mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen – die mir auch alle was bedeuten, schon deshalb -, für den auch der Übergang zwischen Freundschaft und Liebe stets fließend war und als jemand, der davon überzeugt ist, daß Menschen innerhalb solcher freundschaftlichen und liebevollen Verbindungen recht unabhängig von diesbezüglichen Plänen sehr viel über sich und die Welt herausfinden (und meinetwegen: lernen) und sich dabei verändern, muß ich Magnus Klaue dennoch in den meisten Kritikpunkten zustimmen und wundere ich mich darüber, wie wenig Oliver Schott trotz aller diesbezüglichen Lippenbekenntnisse darauf eingegangen ist.
Klaue hat versucht zu fassen, was da gerade geschieht, versucht, es als Ausdruck und nicht die Sache selbst zu sehen; er ist dialektisch an die Sache herangegangen. Und in dieser konkreten Konstellation spielte Schott den Positivisten, der versucht, das Geschehen für die Praxis im Hier und Jetzt in einem Modell festzuhalten. Wenn er Klaue dennoch so weiträumig rechtgibt, bleibt unklar, warum er dann an den Begrifflichkeiten weiter festhält.
Aber: Das falsche Ganze bringt die Möglichkeit (nicht die Gewißheit!) seiner Überwindung selbst hervor. Das spielt sich im Hier und Jetzt ab. Ich gehe in der Regel von Enttäuschungen aus und wurde dann aber – für mich selbst jedesmal überraschend – immer wieder in diesen Enttäuschungen enttäuscht.
Ich würde auch nicht von Arbeit sprechen, schon aber von der Möglichkeit, durch eine gewisse Anstrengung und durch Ringen mit sich und dem je anderen es sich doch trotz der üblen Umstände so erträglich wie möglich zu machen, sich gegenseitig die Kraft dafür zu geben, die Auseinandersetzung mit den Verhältnissen zu führen. Das soll ja keine Forderung sein, die man aneinander heranträgt, sondern etwas, das in dem Maße passiert, wie die Liebe es zu tragen vermag. Ich bin über alles erstaunt und begeistert, was zwischen anderen und mir passiert, würde doch aber niemals glauben, daß es direkt an irgendeiner Veränderung bei ihnen oder bei mir liegt, wie es außerhalb von uns insgesamt aussieht.
Wenn die Intention hinter den Liebesbeziehungen die der Betäubung und Abpanzerung ist, dann ist es ähnlich wie mit dem entsprechenden Drogengebrauch: daß es nämlich dazu führen kann, daß man sich aus den Konflikten der Welt zurückzieht ins vermeintlich immanente private Glück.
Es scheint mir jedoch möglich, auch inmitten von real erfahrener und erlangter Liebe dafür aufmerksam zu bleiben, wie schrecklich die Welt aussieht, vielleicht ermöglicht sie es auch erst, das überhaupt auszuhalten. All my lovin’ won’t calm me down.
Was zur Frage aus “Der kommende Aufstand” nach den Zweckbestimmungen der Einrichtungen, die man sich gibt, führt. Wenn es gar nicht meine Intention oder mein Bedürfnis ist, mich auf diesem Weg abzulenken, abzupanzern oder zu versöhnen, wenn ich jedes Quentchen Liebe als das Besondere und die Ausnahme und das Unwahrscheinliche begreife, das es ja ist, dann schärft sich doch meine Kritik an den Verhältnissen, die dies systematisch verunmöglichen. Voraussetzung wäre aber, daß ich es auch nicht “offene Beziehung” nenne, weil die falsche Immanenz und Versöhnung in dieser Wortgruppe schon impliziert ist.
Auch die Erfahrung der Liebe, die mir zuteil geworden ist, die ich als immer wieder überraschende Segnung empfinde, hat mir doch nie vorgaukeln können, daß damit alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen wären. Wir leben eben nicht in einer freien Assoziation mit guten Menschen und ziehen die Kinder zusammen auf. Das wäre noch viel unwahrscheinlicher als das Liebesglück, das mir schon beschieden ist, weil es noch viel stärker vom falschen Ganzen verunmöglicht wird. (Was aber auch nicht heißt, daß es unmöglich ist!)
(Kleiner Realitätsabgleich: Junger Mann, der hinter mir lief, als ich die Veranstaltung gerade verlassen hatte, wohl zum ersten Mal in Berlin, telefonierte im Gehen mit jemandem außerhalb von Berlin, und betonte, wie kraß er von der Stadt geflasht ist, weil es hier offenbar nur lauter Individualisten gibt und weil immer überall Geschäfte aufhaben.)
Anderswo schrieb ich zum Thema:
Offene Beziehungen, Polyamory und ethisches Schlampentum können, wenn alle Beteiligten ihnen freiwillig zustimmen und mit ihnen emotional zurechtkommen, sehr befreiend wirken, aber eben nur dann. Und so richtig die Überlegung ist, daß erlernte Verhaltensmuster prinzipiell abgelegt werden können, so verheerend scheint es mir, deshalb davon auszugehen, daß dies jedem in der gewünschten Weise durch bloße Selbstkonditionierung gelingen muß. Die offenbar zugrundeliegende Behandlung der somit unerwünschten Gefühle und Verhaltensmuster als bloße Hindernisse finde ich erschreckend. Auch der Versuch, die Gesellschaft durch eine Art Liebes-Solidarität verändern zu wollen bzw. das eigene Liebesleben einer solchen Gesellschaftsvorstellung anzupassen, erscheint mir gefährlich, da ich eine gesellschaftliche Vermittlung unabhängig von der jeweiligen wechselseitigen Zuneigung der konkreten Personen für eine zivilisatorische Errungenschaft halte.
Etwas so Unberechenbares, Willkürliches und auch in nicht-monogamen Formen in bezug auf die meisten Menschen Ausschließendes wie Liebe taugt schlecht zum Gesellschaftsprinzip. Wenn es darum geht, gesellschaftlich bestimmte Ansprüche oder Rechte geltend zu machen, sollte das auf keinen Fall (nur) von Zuneigung abhängig sein.
Aus meiner Sicht ist Gesellschaft im besten Fall, indem sie eben jedem ohne Ansehen der Person verpflichtet ist, ein Schutz für Ungeliebte, Unbeliebte, Marginalisierte, Andersliebende usw.


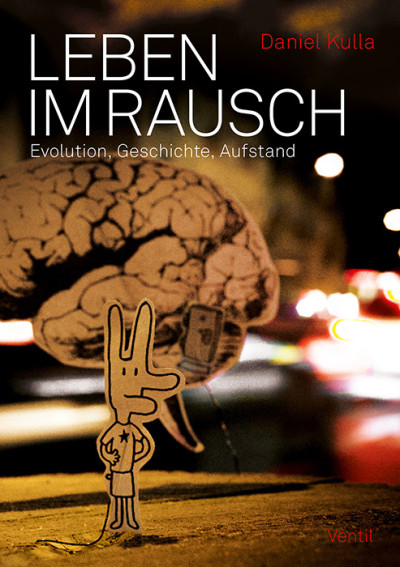






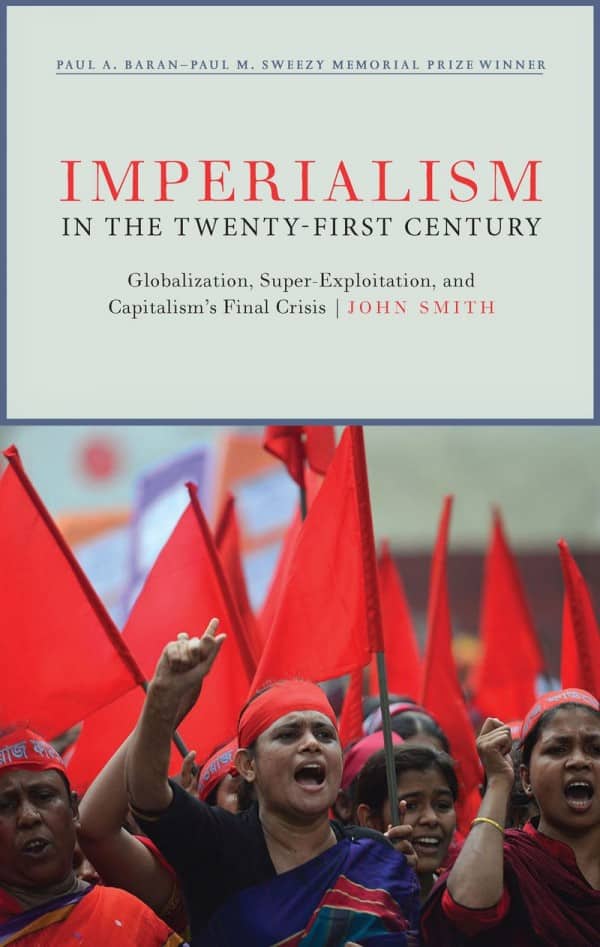







September 23rd, 2011 at 12:27
tl, dr
September 23rd, 2011 at 13:10
danke!
September 23rd, 2011 at 17:15
Vielen Dank für die lesenswerte Zusammenfassung!
September 24th, 2011 at 21:40
“Für Schott gibt es ein Bedürfnis nach Namen für die Sache, die man treibt, am besten eine Sache mit Wikipedia-Eintrag. Dieser Bewegungsdynamik hält er die “offene Beziehung” entgegen, die nach keiner Schablone ablaufen soll, sondern offen in dem Sinn, daß es immer um Einzelfallentscheidungen geht.”
Das ist doch, abgesehen von den ganzen Meta-Diskussionen, genau richtig. Beziehungen aller Art sind immer Zweier-Beziehungen und, weil eben immer andere Menschen beteiligt sind, immer verschieden. So kann ich mit verschiedenen Leuten “gleich gut” befreundet sein und dabei mit der einen Person z.B. gelegentlich Sex machen und mit anderen nicht. Mein Wort dafür: Zärtlichkeit, als Handlung, aber vor allem als Gefühl. Gibt es Literatur zu einer Theorie der Zärtlichkeit? (Ich kenne nur den Barthes-Eintrag in den Fragmente einer Sprache der Liebe.)
September 26th, 2011 at 09:39
Danke auch von mir für die Zusammenfassung und die Gedanken!
September 28th, 2011 at 02:21
Es ist nicht leicht dem inhaltlich noch etwas hinzuzufügen, außer vielleicht die Feststellung wie schön es ist wenn sexuelle Selbstbestimmung so selbstverständlich voraussetzbar ist wie es in diesem Diskurs impliziert wird.
Eine plausible Metatheorie der Sexualität setzt die Einsicht voraus dass immer alle Wege offen stehen müssen. Sobald einzelne davon gezielt versperrt werden um so andere davon relativ attraktiv zu machen, fällt die gesamte zwischenmenschliche Inspiration dem Kalkül des Nullsummenspiels zum Opfer. Polyamory, Promiskuität, Monogamie, Entsagung, was auch immer ist nur selbstbestimmt lebbar wenn es auch anders ginge. Im Umkehrschluß bedeutet das, sobald es darum geht dafür zu sorgen dass es nicht mehr anders geht wird sich jedes Sexualitätsideal verkrampfen. Um dieses Problem auch in diesem Kontext zu sehen ist es eigentlich nicht nötig sexualethisch sozusagen das Rad nocheinmal zu erfinden. Wenn es doch geschieht, dann heißt das dass sexuelle Selbstbestimmung als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit erwartet wird obwohl man sich doch gerade bewusst zu machen versucht dass die Personen aus denen sich die Gesellschaft zusammensetzt sie erst noch erlernen müssen. Die Widersprüchlichkeit dieser Position ist allerdings weniger schön.
http://de.indymedia.org/2011/06/310341.shtml
Währenddessen finden in dieser Gesellschaft Verluste an allgemeiner Selbstbestimmung statt, deren sexualpolitische Dimensionen bislang weitgehend undokumentiert sind. Wenn sexuelle Selbstfindung eine wesentliche Beschäftigung der Berliner ist und die Stadt der Ort mit der höchsten Observationsdichte im ganzen Land, dann stellt sich auch das Problem der Überschneidung dieser Erscheinungen. Gemessen an dem Risiko das davon für die sexuelle Selbstbestimmung als universalistisches Prinzip ausgeht, dürften sich selbst die klerikalen Mißbrauchsskandale vergleichsweise eher bescheiden ausnehmen. Im Titel der Veranstaltung ist bereits der panoptische Blick impliziert, bzw. das höhlengleichnisartige Zerrbild des menschlichen (Sexual-)Lebens welches die Überwachung den Tätern liefert. Dass nur Bigotte diese Rolle ausfüllen weil es ohne Rechtfertigungsideologie gar nicht geht hat wohl in keinem anderen Lebensbereich üblere Folgen als bei der Observation der Sexualität. Eine offene Beziehung in einem geschlossenen Polizeistaat ist unverkennbar ein Widerspruch, und die sexuelle Selbstfindung unter Observationsdruck verlangt von den Betroffenen, um sich wehren zu können das zu sein was sie wären wenn sie sich nicht wehren bräuchten, d. h. ebensoviel vorauseilende und nachholende Entwicklung wie jede andere Nahtodeserfahrung.
https://indymedia.org.uk/en/2011/09/484679.html
Dahingegen sind klerikal Betroffene mit ihren Erlebnissen nicht so allein, weil es dafür einen gesellschaftlichen Wortschatz gibt und das Schweigen nur ein Moment personenbezogener Verantwortungslosigkeit ist und kein allgemeines Problem der Ausdrucksform. Selbstbestimmte Sexualitäten müssen sich nicht unbedingt immer in allgemeinverständliche Worte fassen lassen, Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung allerdings schon.
October 5th, 2011 at 17:56
Aha.